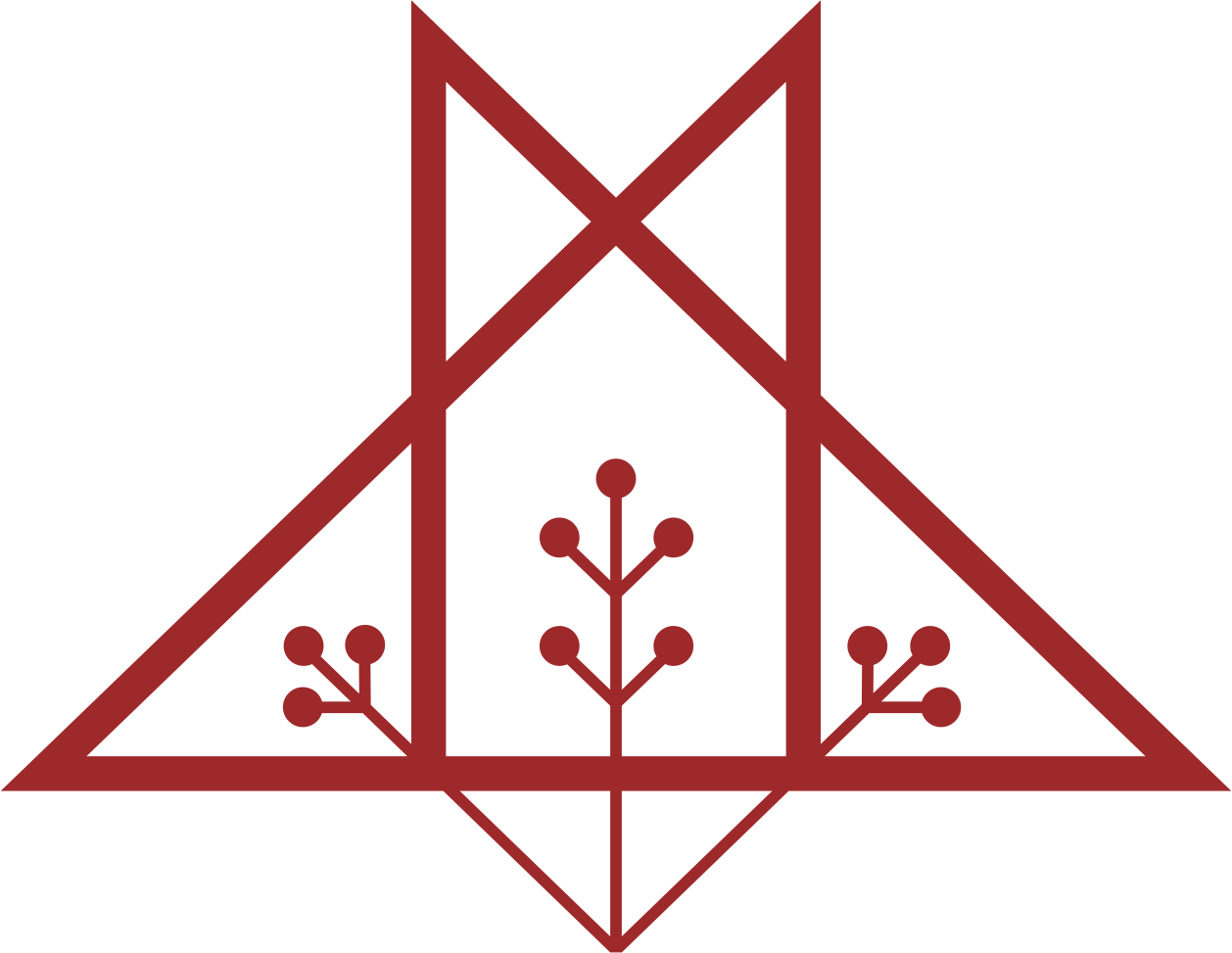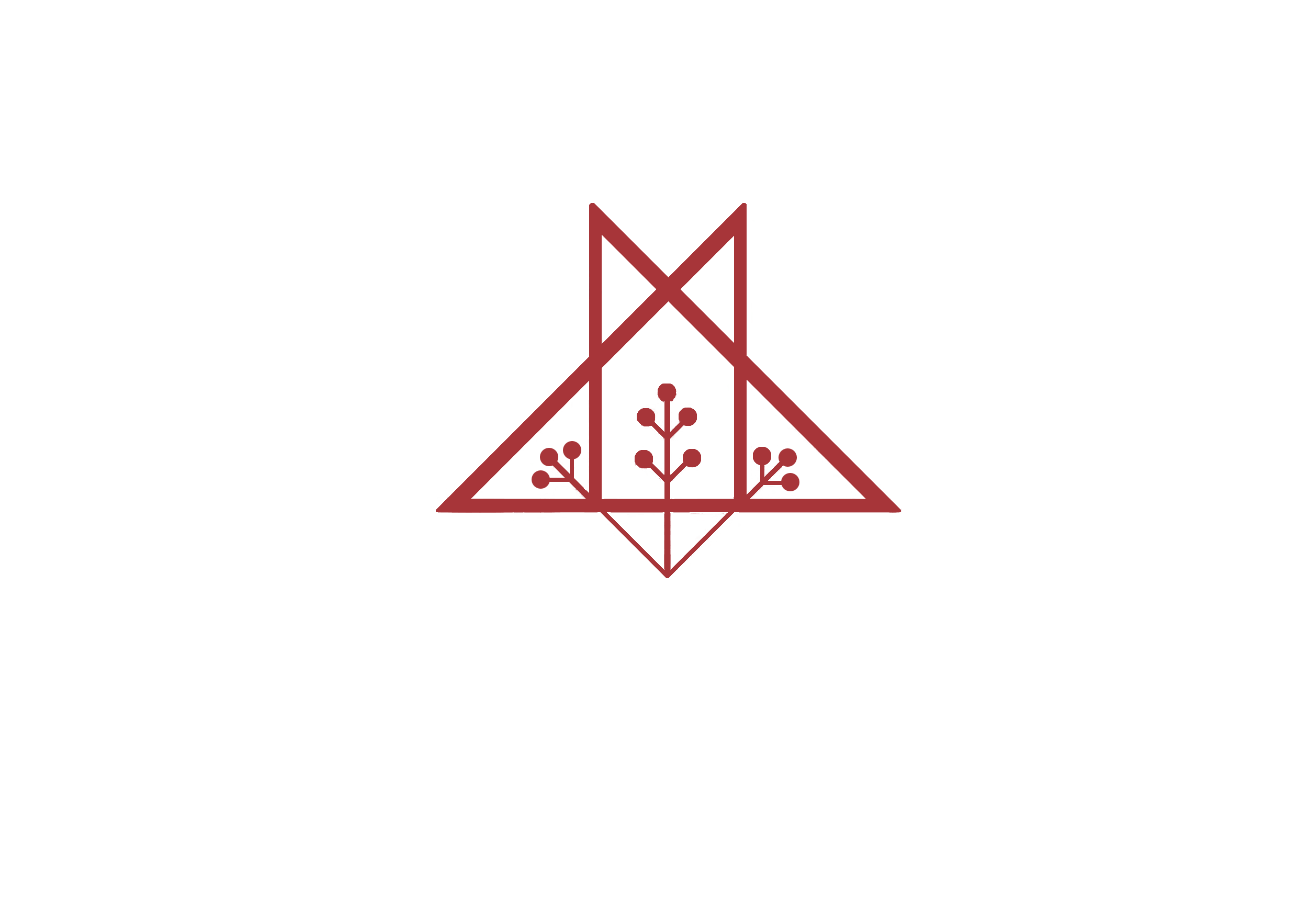Geringe Löhne bewirken Emigration, Frustration und Skepsis
Kohlekräne am Rigaer Hafen, Foto: A. Buks - Paða darbs, CC BY-SA 2.5, Saite
“Nothing special” antwortete ein ehemaliger lettischer Finanzminister* zur Zeit der Finanzkrise auf die Frage eines englischsprachigen Journalisten, was mit der lettischen Wirtschaft los sei. Diese Antwort wurde zu einem geflügelten Wort. Lettland gehörte zu den Ländern der EU, deren Bevölkerung das Streben der Banker nach maximalem Profit am meisten zu spüren bekam: Sie zahlte mit Erwerbslosigkeit, geringeren Einkommen und Emigration für riskante Hypothekenkredite in einer Fremdwährung. Doch die Finanzkrise war nur die Spitze des Eisbergs. Die keynesianisch orientierten Ökonomen Heiner Flassbeck und Friederike Spiecker lassen in einem Beitrag, den sie provozierend "The Forgotten European Hinterland” nennen, womit sie die osteuropäischen EU-Länder meinen, die letzten 15 Jahre mit Bezugnahme auf die baltischen Länder Revue passieren (flassbeck-economics.com). Es zeigt sich: Die strukturellen Probleme zwischen westlichen/nördlichen EU-Staaten einerseits und östlichen/südlichen andererseits sind bis heute nicht gelöst und können mit der Ideologie einer deregulierten “freien Marktwirtschaft” auch nicht gelöst werden.
Vor 2008 schien die lettische Welt in Ordnung. Die Löhne stiegen rasch, die Banken boten günstige Kredite im zinsgünstigeren Euro an, obwohl die nationale Währung immer noch Lats hieß. Wer sich auf die Werbung der Immobilienwirtschaft und der Banken verließ, musste zum Schluss kommen, dass es verrückt wäre, sich keine Immobilie zuzulegen. Ein Haus kaufen schien leichter und kostengünstiger als eine Wohnung zu mieten. Die Bankkunden ahnten nicht, dass sie sich zum Spielball von Devisenspekulanten machten und sie fortan von schwankenden Wechselkursen abhingen. Die Regierung überließ Hauskäufer ihrem Schicksal, die sich oft übernahmen, weil das Eigenkapital fehlte. Wer genauer hinsah, dem wurde schon vor 2008 mulmig: Wie eine Fieberkurve erhöhte sich die lettische Inflationsrate weit über dem EU-Durchschnitt. Die raschen Lohnerhöhungen führten zu einer Lohn-Preis-Spirale. Lettische Unternehmen mussten die Preise stärker anheben als die ausländische Konkurrenz, verloren also Wettbewerbsfähigkeit.
Die Kombination aus zu raschen Lohnerhöhungen und eines kreditfinanzierten Wirtschaftswachstums, vor allem in der Bauindustrie, blähte die Blase bis zur Finanzkrise, bis schließlich einige Wochen nach den Lehman-Brothers auch das damals größte private lettische Kreditinstitut, die Parex-Bank, vor der Insolvenz stand. Sie hatte sich mit spekulativen Geschäften übernommen, die Blase war geplatzt. Banker hatten lettische Kunden als sichere Kapitalvermehrung für Eurogeld entdeckt: Entweder zahlten sie Zinsen oder der Bank blieb bei einer Pleite das Eigenheim. llmars Rimsevics, Leiter der lettischen Zentralbank, empfahl der Regierung, die Parex auf Kosten des Staatsbudgets zu “retten”. Doch dafür musste sich Lettland selbst Geld leihen, das die internationalen Investoren auf den Finanzmärkten nicht mehr zur Verfügung stellten, denn inzwischen hatten die privaten US-Ratingagenturen Lettland auf Ramschniveau herabgestuft. Dabei waren lettische Regierungen aufgrund ihrer wirtschaftsliberalen Grundsätze stets sparsam gewesen. Die prozentuale Gesamtverschuldung des lettischen Staatsbudgets am BIP blieb weit hinter derjenigen westlicher Länder zurück, auch während und nach der Krise; nur die notwendige Neuverschuldung, mehr als drei Prozent vom BIP, übertraf in den Parex-Rettungsjahren das Maß, das die Maastrichtkriterien zulassen. Die Auslandsschulden hatte nicht die Regierung zu verantworten, sondern Bürger, die Euro-Kredite aufgenommen hatten. Staaten mit Auslandsschulden, ob privaten oder staatlichen, machen sich von internationalen Kreditgebern abhängig.
Die lettische Regierung wandte sich an den Internationalen Währungsfonds (IWF) und die EU, um die notwendigen Ausgaben mit einem Sieben-Milliarden-Kredit zu finanzieren, auch Schweden und Dänemark beteiligten sich an der “Lettlandhilfe”, nicht aus uneigennützigen Gründen, wie sich bald herausstellte. Damals übernahm der heutige EU-Kommissar Valdis Dombrovskis die Regierung. Er verhandelte mit den IWF-Experten, die die Abwertung des Lats empfahlen, was die lettische Wirtschaft gegenüber der ausländischen Konkurrenz gestärkt hätte. Doch Schwedens Regierung stellte sich quer. Ihre Swedbanka hatte sich im lettischen Immobiliengeschäft mit Euro-Krediten engagiert. Bei einer Abwertung des Lats hätte abrupter Zahlungsausfall der Kreditnehmer gedroht. Schweden übte auf Lettland Druck aus, um das zu verhindern. Dombrovskis` Kabinett verzichtete auf eine Abwertung, begann stattdessen mit einer Kürzungspolitik, die fortan als “innere Abwertung” bekannt wurde. Staatliche Angestellte wurden entlassen oder ihre Gehälter um ein Drittel und mehr gekürzt. Manche Häuslebauer gerieten somit trotz stabilen Lats` in Nöte, weil sie entlassen wurden oder empfindliche Einbußen beim Einkommen hinnehmen mussten. Da die Immobilienpreise fielen, hatten sie bei der Bank trotz Hausverkaufs noch Schulden, für die sie weiter zu zahlen hatten, für nichts und wieder nichts. Flassbeck und Spiecker weisen im Hinblick auf diese fragwürdigen Bankgeschäfte in Osteuropa auf Ungarn, das ähnliche Probleme hatte. Damals kam Viktor Orban aufgrund der Finanzkrise ein zweites Mal an die Macht. Er sorgte dafür, dass ungarische Bankkunden die Fremdwährungskredite bei steigenden Zinsen zu vertretbarem Wechselkurs in Forint zurückzahlen konnten. Bei einer Abwertung des Lats hätte sich Dombrovskis` Kabinett um ähnliche Erleichterungen für überforderte Bankkunden bemühen können.
Die Kürzungspolitik der lettischen Regierung betraf alle Einwohner. Die Letten mussten eine der stärksten Rezessionen in der EU verkraften, weil die Sparpolitik die eigene Wirtschaft strangulierte. Der Gesundheitsminister trat zurück, weil er die Einsparungen in seinem Ressort nicht verantworten wollte. Während die Merkel-Regierung in ihrer Not viele Milliarden Schulden aufnahm, um die heimische Industrie zu retten - man erinnere sich an die berüchtigte Abwrackprämie für noch brauchbare Autos - hieß es für Letten, sich in den Ruin zu sparen. Begleitet wurde die Strangulierung vom vergifteten Lob deutscher Diplomaten, die der lettischen Einsicht ins angeblich Notwendige Anerkennung zollten. Die Medien redeten den nationalbewussten Letten ein, dass sie stolz auf ihre Vernunft sein könnten. Michael Hudson, ein Kritiker der Finanzmärkte, der die lettische Misere jener Jahre beobachtete, sprach vom “Stockholmsyndrom” der Letten: Sie identifizierten sich mit den Forderungen ihrer Peiniger wie die Geiseln mit den Forderungen von Terroristen. Letten, die nicht mehr über die Runden kamen, suchten ihr Glück im westlichen Ausland. Zwischen 2010 und 2011 erreichte die Arbeitsemigration ihr Maximum: Am 1. Januar 2011 registrierten lettische Behörden 45.899 Einwohner weniger als ein Jahr zuvor.
Doch die Regierung propagierte diese Wirtschaftspolitik als “Veiksmes stasts”, als Erfolgsgeschichte. Sie orientierte sich mit ihrer Kürzungspolitik an den monetaristischen Maastricht-Kriterien, so dass Lettland 2014 den Euro einführte. Zur gleichen Zeit wetterte der damalige lettische Finanzminister gegen die Griechen. Ein österreichischer EU-Abgeordneter beobachtete, dass gerade die osteuropäischen Politiker auf harte Sparmaßnahmen in Griechenland drängten, denn der griechischen Bevölkerung sollte es nicht besser ergehen als der eigenen.
In den Jahren bis zur Pandemiekrise stabilisierte sich die Lage. Die Zahl der Emigranten verringerte sich, doch der Bevölkerungssaldo ist bis heute negativ. In den letzten Jahren stiegen in vielen Branchen die Löhne, doch der Abstand zum Lohnniveau westlicher Länder bleibt beträchtlich. Der ganz große Sprung nach vorn blieb aus; die Angleichung der Lebensverhältnisse bleibt für die meisten Letten ein Lippenbekenntnis von EU-Politikern, das nicht mit einer entsprechenden Politik verbunden ist. Der ehemalige lettische Ministerpräsident Maris Kucinskis beklagte, dass trotz Euro-Einführung und geringer lettischer Kapitalsteuern zuwenig investiert werde. Investitionen wären aber notwendig, um die Produktivität zu erhöhen, denn nur die kostengünstige Produktion von Gütern durch stetig steigende Produktivität ermöglicht gleichzeitig bessere Löhne und Preisstabilität.
Für Flassbeck und Spiecker ist die unterschiedliche Entwicklung der Lohnstückkosten das entscheidende ökonomische Maß, das die strukturellen Probleme des EU-Binnenmarkts und der Eurozone erklärt. Sie sind das Maß der Wettbewerbsfähigfähigkeit eines Unternehmens und eines Landes. In der produktiveren Fabrik, in deren Werkshallen Arbeiter mit modernsten Maschinen Ware schneller und günstiger herstellen, können die Beschäftigten mehr verdienen als in einer weniger produktiven, wo die Maschinen veraltet sind oder ganz fehlen. Eventuell, wenn der technische Vorsprung groß genug ist, kann die Firma mit den moderneren Maschinen trotz höherer Löhne die Ware sogar billiger anbieten und den Konkurrenten mit veralteter Technik vom Markt verdrängen.
Weil zu wenig investiert wird, bleibt die Produktivität in den osteuropäischen Ländern zu weit zurück, um in der Konkurrenz mit westlichen EU-Ländern zu bestehen. Dennoch steigen die Löhne stetig und überdurchschnittlich. Laut Flassbeck und Spiecker erhöhten sich die Löhne in der Eurozone innerhalb von zehn Jahren um durchschnittlich 2,2 Prozent jährlich, in Bulgarien waren es 7,7 Prozent, in Lettland 7,6 Prozent. Die osteuropäischen Regierungen befinden sich in einem Dilemma: Bleiben die Löhne zu gering, dann emigriert die erwerbstätige Bevölkerung; steigen sie spürbar und schneller als die Produktivität, gefährdet das die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft. Trotz hoher Lohnsteigerungen ist Lettland im EU-Vergleich immer noch ein Niedriglohnland; das ist der bislang größte Standortvorteil. In den letzten Jahren hatte die mittlere Baltenrepublik eine chronisch negative Handelsbilanz, das heißt: ständig wurde mehr Warenwert im- als exportiert. Dennoch konnte Lettland seine Leistungsbilanz, die neben dem Handel auch die Dienstleistungen erfasst, weitgehend ausgleichen, weil lettische Firmen ihren Service im Ausland aufgrund geringer Löhne billiger anbieten konnten. Das zeigt sich an lettischen Speditionen. Weil lettische Lkw-Fahrer deutlich weniger verdienen, können sie westliche Konkurrenten ausbooten. Die Initiative westlicher EU-Abgeordneter, die Arbeitsbedingungen für Berufsfahrer zu verbessern und ihre Chefs zu verpflichten, die Mindestlöhne zu zahlen, die im jeweiligen Land gelten, wo ihre Angestellten unterwegs sind, kam bei osteuropäischen Politikern gar nicht gut an. Sie hatten den Verdacht, dass die eigenen Speditionen vom Markt verdrängt werden sollten und warfen westlichen Politikern Protektionismus vor.
Von einer ernsthaften Bemühung, die Lebensverhältnisse anzugleichen, kann bei der gegenwärtigen EU-Politik nicht die Rede sein. Nach einseitigen, auf Wachstum und an ausgeglichenen Staatsbudgets ausgerichteten Kriterien stellt die EU-Kommission den osteuropäischen Ländern gute Zeugnisse aus, die aber nicht die wirtschaftliche Wirklichkeit der Bevölkerung widerspiegeln. Flassbeck und Spiecker kommen zu einem düsteren Fazit: “Dennoch - Im Gegensatz zu den europäischen Statistikern und Analysten hat die Bevölkerung ein sehr gutes Gespür dafür, dass irgendetwas schief läuft. Man erkennt die große Abhängigkeit von ausländischen Unternehmen, man spürt die Lücken in der Bevölkerung, die durch die Emigration zerrissen wurde, die Inkompetenz der zunehmend schwächer werdenden demokratischen Institutionen und die Unfähigkeit der eigenen Regierung, einen grundsätzlichen Wandel herbeizuführen. Die Folge ist eine allgemeine Frustration, eine Hinwendung zum Nationalismus und eine zunehmende Infragestellung der Demokratie.”
* An dieser Stelle schrieb ich ursprünglich Wirtschaftsminister, das war ein Fehler.
Udo Bongartz
Atpakaï