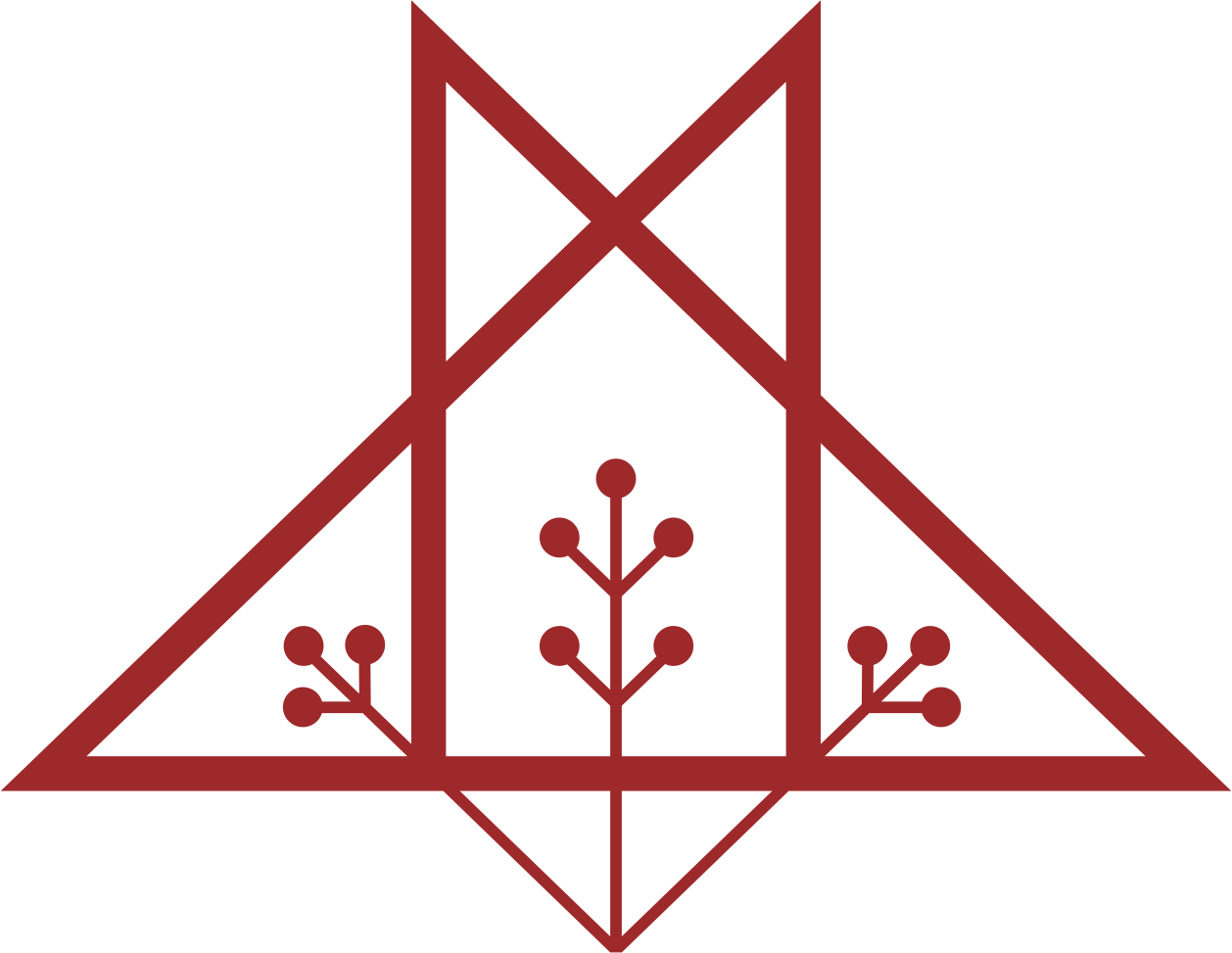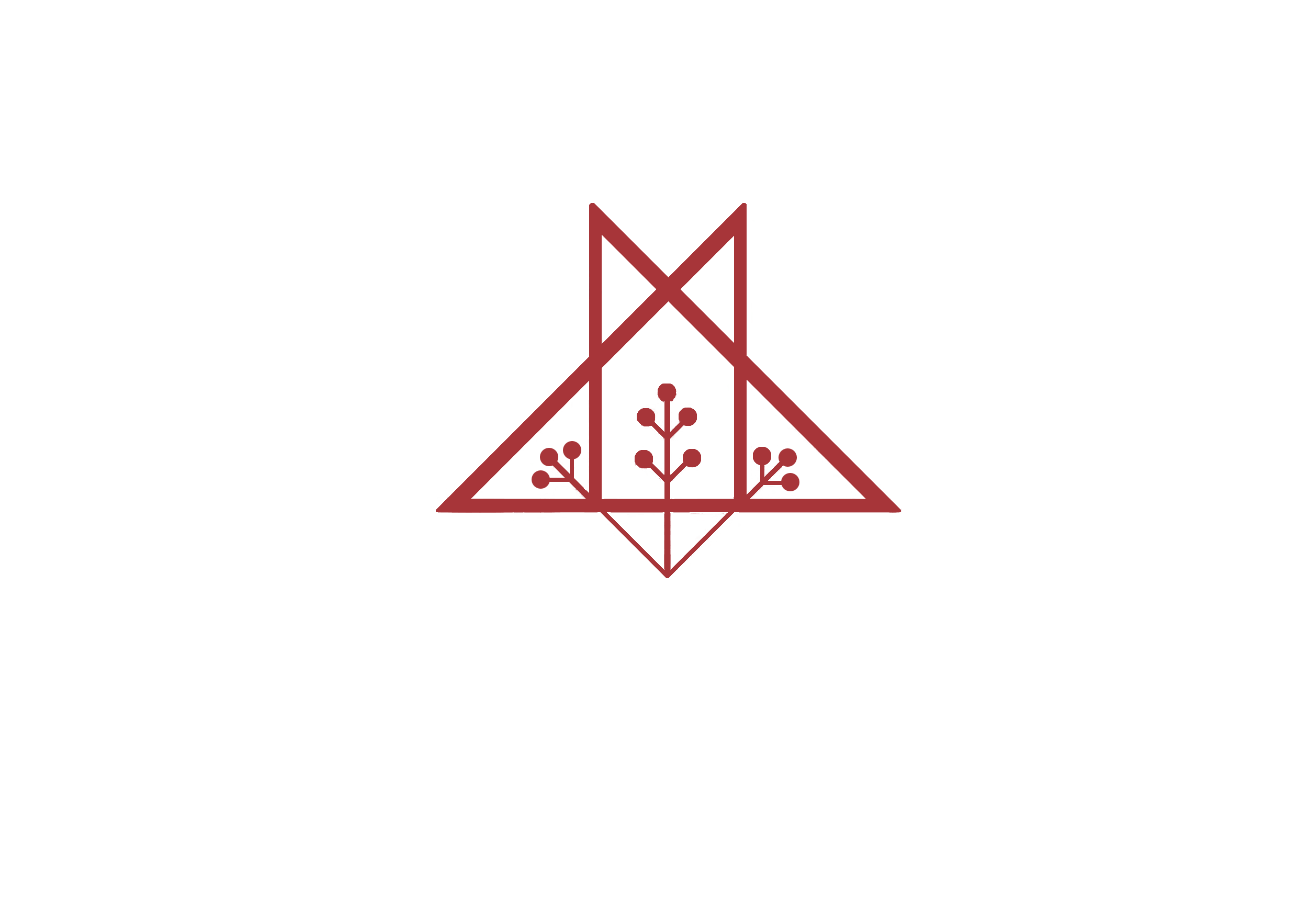Für Menschen mit geistigen Behinderungen planen lettische Kommunen neue Wohnformen
08.08.2022
Lettland “deinstitutionalisiert” seine Behindertenunterkünfte
Das Sozialministerium in Riga, Foto: Egilus, Paða darbs CC BY-SA 4.0, Saite
Ieva Leimane-Veldmeijere leitet das Zentrum für Menschen mit psychischen Störungen ZELDA. Sie beobachtet, dass Familien mit behinderten Angehörigen diese häufig bevormundeten: “Es ist so, dass der Betroffene vielleicht selbst etwas anderes wünscht, aber die Familie drängt ihm ihre Vorstellung auf, dass er dies und das benötige. Ja, das ist eine Herausforderung. Gewiss werfen wir das nicht den Familien vor, denn sie setzen sich für den Angehörigen ein und kümmern sich um ihn; das wird stets mit allerbester Absicht getan. Zuweilen ist es schwer, einen Schritt zurückzutreten und von der Seite zuzuschauen, um dem Betroffenen die Möglichkeit zu lassen, etwas selbst zu entscheiden und selbst Entschlüsse zu fassen.” (lsm.lv) Leimane-Veldmeijere beobachtet einen Paternalismus, der sich in der Gesellschaft verbreitet habe. Ein Problem sei es, dass nur negative Beispiele, wenn etwas nicht funktioniere, die Öffentlichkeit erreichten. Daraus würden negative Stereotypen entstehen, Vorurteile wie: “Nun ja, aber sie sind nicht imstande, etwas selbst zu entscheiden, sie vermögen nicht, mit sich fertig zu werden, sie sind gefährlich, sie sind aggressiv,” zitiert die ZELDA-Aktivistin. Insassen von Institutionen, in denen Heimatmosphäre herrscht, leiden ebenfalls unter einem Alltag, in dem das meiste vom Tagesablauf des Personals bestimmt wird und, falls die Heimbewohner in Mehrbettzimmern leben, ihnen keine Intimsphäre verbleibt. Wie Behinderte in den herkömmlichen lettischen Sozialzentren leben müssen, wurde von Juris Jansons, dem Ombudsmann für Menschenrechte, kritisiert. Der Soziologe Erving Goffman beschrieb solche Einrichtungen als “totale Institution” und entdeckte Gemeinsamkeiten mit Gefängnissen. Lettland hat die UN-Behindertenkonvention von 2009 unterzeichnet. Diese sieht eine “Deinstitutionalisierung” vor, d.h., dass psychisch Behinderte möglichst selbstbestimmt wohnen sollen. Lettische Kommunen haben begonnen, im Sinne der UN-Konvention für die Betroffenen neue Einrichtungen zu schaffen: die “Gruppenhäuser”.
In Rezekne ließ die Kommune für eine Million Euro einen alten Kindergarten umbauen (rezekne.lv). Es ist ein zweistöckiges Gruppenhaus für 16 psychisch Behinderte entstanden, jeder hat sein eigenes möbliertes Zimmer mit Bad. Zudem verfügen die Bewohner über eine Gemeinschaftsküche und einen Freizeitraum; die üblichen Haushaltsgeräte stehen zur Verfügung. Rund um die Uhr leistet teilzeitbeschäftigtes Pflegepersonal Hilfe. Im Juli sind die ersten vier Bewohner eingezogen, einer von ihnen äußert sich gegenüber der LSM-Journalistin Lasma Zute-Vitola sehr zufrieden: “Das ist ein sehr wertvolles Geschenk. Ich bin sehr glücklich. Schränke, Annehmlichkeiten, Dusche, ein eigenes Zimmer mit Möbeln und Bett. Das ist Selbstständigkeit. Wir lernen selbst, das Essen zuzubereiten und machen auch anderes, wir gehen ins Geschäft und wir haben Helfer.” (lsm.lv) Gunars Arbidans, der den örtlichen Sozialdienst leitet, erläutert, dass die Bewohner des Gruppenhauses tagsüber beschäftigt werden. In speziellen Werkstätten lernen sie, Werkzeuge zu benutzen, um mit Holz zu arbeiten oder Kerzen zu gießen. Für manche könne der Umzug ins Gruppenhaus sogar der Start in ein selbstbestimmtes Leben bedeuten.
Sigita Rozentale, Vertreterin des Sozialministeriums, begrüßt, dass lettische Kommunen Wohnräume für ein selbstbestimmteres Leben planen (lsm.lv). Bislang sind 21 Gruppenhäuser für 299 Bewohner entstanden, bis zum nächsten Jahr sollen 50 Gruppenhäuser für weitere 600 Menschen hinzukommen. Derzeit übersteige die Nachfrage noch deutlich das Angebot. Viele Familien fragten nach einem Platz im Gruppenhaus nach. Sie schätzten das Angebot, weil sie ihre Angehörigen dort versorgt und sicher wissen. Rozentale bedauert, dass sich 13 Kommunen noch nicht um die Planung solcher Projekte gekümmert haben. Um für Integration und Verständnis zu werben, hat das Sozialministerium die Kampagne “Ein Mensch, keine Diagnose” gestartet.
Juris Jansons, der Ombudsman für Menschenrechte, hält mehr Aufklärung für erforderlich (tiesibsargs.lv). Im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Gruppenhäuser, die Jansons sehr begrüßt, befürchtet der Jurist Anfeindungen und Vorurteile. Die Gesellschaft sei über Menschen mit psychischen Störungen schlecht informiert, es fehle an Verständnis. Bei derartigen Projekten in Ogre oder Adazi sei die Intoleranz offenkundig gewesen. Der Ombudsman zeigte sich in einem eigenen Beitrag über das “Kulturniveau” der Debatte besorgt, nannte aber keine Einzelheiten. Er wies darauf hin, dass Menschen mit psychischen Störungen ein teil der Gesellschaft sind. Die Einstellung und das Verhalten gegenüber den Betroffenen spiele eine wesentliche Rolle, ob das Zusammenleben gelingt. Auch deren Familien benötigten Unterstützung. Doch insgesamt bedeuten die neuen Einrichtungen für Jansons einen klaren Fortschritt: Mehr als zehn Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenkonvention zeige sich, dass “Kommunen, die gezielt Ressourcen investierten, um das Leben behinderter Menschen zu verbessern, Resultate erzielen, die jedem ermöglichen, sich in einer integrierenden Umgebung zu leben und sich zu vervollkommnen.”
Udo Bongartz
zurück